Jeden Tag verpassen viele Menschen auf der ganzen Welt die Restocks und Releases
limitierter Schuhe. Wir sind der Meinung, dass niemandem so ein trauriges Schicksal
widerfahren sollte. Vielmehr sollte jeder seine heißgeliebten Sneaker direkt und ohne
Umwege ergattern dürfen. Wir können zwar nicht dafür sorgen, dass mehr Kicks produziert
werden und so nie wieder jemand leer ausgeht, allerdings können wir dafür eure Chancen
für einen Win drastisch erhöhen.
Mit unserem Sneaker Release Kalender erhaltet ihr so nämlich einen detaillierten Überblick
über eine Vielzahl von anstehenden Veröffentlichungen, noch bevor sie jemand anderes
überhaupt kennen kann! Grailify hält euch durchgehend auf dem neuesten Stand, sodass ihr
euren nächsten potenziellen Kauf ständig im Blick habt und definitiv rechtzeitig ready-to-cop
seid.
Über den Veröffentlichungszeitpunkt eines Sneakers Bescheid zu wissen, reicht allerdings
insbesondere bei den sehr limitierten Modellen einfach nicht aus. Viele Kicks sind nämlich
bereits nach wenigen Sekunden in einem Shop ausverkauft, sodass man schnellstmöglich
zu einem anderen Verkäufer switchen sollte. Wenn man nun allerdings überhaupt keinen
Plan hat, welche übrigen Retailer das heißbegehrte Modell sonst noch vertreiben, dann
könnte sich der gewünschte Kauf ganz schnell zum absoluten Fail entwickeln.
Dementsprechend gibt euch unser Sneaker Release Kalender auch bei jedem Schuh eine
Übersicht darüber, bei welchen Shops sich das jeweilige Modell alternativ noch erwerben lassen könnte.
Du entscheidest, welche Sneaker Releases du sehen willst!
Mit dem Sneaker Release Kalender bleibt ihr nicht nur ständig up-to-date, sondern könnt
auch völlig individuell entscheiden, welche Schuhe ihr überhaupt sehen möchtet. Neben der
chronologischen Auflistung nach Veröffentlichungsdatum könnt ihr so nämlich ganz bequem
die verschiedensten Filtereinstellungen nutzen, um den Release Kalender auf eure
Bedürfnisse abzustimmen.
Feiert ihr die Sneaker einer ganzen bestimmten Marke besonders hart und interessiert euch
sowieso nur für ihre Kicks? Für diesen speziellen Fall haben wir extra die Kategorie Brands
eingebaut, damit ihr auch nur die neuesten Sneaker Releases eurer Lieblingsmarke
angezeigt bekommt. Das könnt ihr natürlich auch noch ein Stückchen weiter treiben und
euch sogar auf ganz bestimmte Schuhreihen oder Modelle beschränken.
Gefallen euch so beispielsweise insbesondere die Nike Air Force 1 Sneaker, so könnt ihr
in unseren Filtereinstellungen genau dieses Modell auswählen und wisst direkt ausschließlich
über die anstehenden Veröffentlichungen dieses Modells Bescheid.
In einer Zeit der absoluten Reizüberflutung kann es schon mal ganz nützlich sein, sich nur
auf das Wesentliche beschränken zu dürfen.
Neu und bislang einzigartig ist unsere Kategorisierung nach Kollabos!
Ihr sucht Sneaker eines speziellen Kollaborationspartners, wie Travis Scott,
Salehe Bembury, Bad Bunny,
Trophy Room oder KAWS?
Kein Problem, wir listen die angesagtesten Releases und ihre
Kollaborationspartner für euch auf.
Darüber hinaus haben wir übrigens auch einen Preisfilter in unseren Sneaker Release
Kalender integriert, damit ihr die volle Kontrolle darüber habt, wie viel ihr letztendlich für die
anstehenden Schuh Veröffentlichungen ausgeben wollt und welche Modelle so überhaupt
bei eurem Budget in Frage kommen.
Es soll bekanntlich noch rational denkende Menschen geben, die keine 700€ für die
allerneuesten Kicks ausgeben. 😉 Wenn ihr das nun mit dem Brand Filter kombiniert, könntet
ihr so nun noch effektiver als jemals zuvor nach eurem nächsten potenziellen Cop suchen.
Wie man es von einem guten Release Kalender selbstverständlich erwartet, haben wir
neben dem individuellen Preisfilter natürlich auch die typischen Filterfunktionen, wie die
Sortierung nach niedrigstem und höchstem Preis zu bieten. Dementsprechend werden euch dann in den von euch
gesetzten Limits die jeweiligen Schuh Releases angezeigt. So spart
ihr euch viel Zeit und Nerven bei der Suche nach den richtigen Sneakern!
Mehr als nur ein Release Kalender
In erster Linie ist es uns natürlich am wichtigsten, dass ihr bezüglich der Sneaker Releases
jederzeit auf dem neuesten Stand seid und immer über die anbietenden Shops Kenntnis
habt. Der Kalender ist aber bei Weitem mehr als nur eine Liste! Jeder einzelne Schuh erhält
von uns die dazugehörige Background Story und die entsprechenden Release Infos sowie
News. Falls euch ein Sneaker also besonders gefallen sollte, dann könnt ihr euch die häufig
sehr interessante Entstehungsgeschichte zusätzlich durchlesen.
Grailify ist immer nur einen Klick entfernt
Heutzutage existieren zahlreiche Informationskanäle, mit denen man sich über zigtausende
Themen auf den neuesten Stand bringen lassen kann. Warum dann nicht auch gleich über
Sneaker Releases? Jeder Schuh-Enthusiast bevorzugt dabei vermutlich einen anderen
Weg, um sich über die Veröffentlichungen seiner geliebten Kicks zu informieren. Grailify
möchte euch dementsprechend nicht nur einen sehr individuell anpassbaren Release
Kalender bieten, sondern euch auch direkt die freie Wahl über den gewünschten Weg der
Informationsbeschaffung ermöglichen.
Die Grailify Sneaker App
Die Grailify Sneaker App bringt euch alle Vorteile des Release-Kalenders völlig unkompliziert
und vor allem kostenlos auf euer Android- oder Apple-Smartphone. Dazu gehört
selbstverständlich auch das Haupt Feature in Form des Kalenders, welcher euch über alle
wichtigen Sneaker Releases auf dem Laufenden hält und euch zweifelsfrei einen guten
Überblick verschafft.
Logischerweise erfahrt ihr somit natürlich auch, in welchem Shop euer jeweiliger Liebling zu
holen ist. Doch das war natürlich noch lange nicht alles! Der Kalender selbst ermöglicht
euch das Einrichten eines Release-Weckers, der euch eine Push-Benachrichtigung direkt
auf euer Handy sendet.
Ihr könnt dabei natürlich frei entscheiden, bei welcher Veröffentlichung eine Erinnerung
angezeigt werden soll und wie weit im Voraus das dann letztendlich passiert.
Wenn ihr nun also beispielsweise endlich mal einen heißbegehrten Air Jordan 1 Sneaker
oder Nike Dunk ergattern wollt, dann erinnert euch die App völlig automatisch daran, dass
das Release bereits vor der Tür steht.
Mit diesem Feature seid ihr bei eurem nächsten Cop also definitiv auf der sicheren Seite.
Darüber hinaus könnt ihr jeden einzelnen Sneaker im Release Kalender zu euren
persönlichen Favoriten hinzufügen, um eure Lieblinge damit auf gar keinen Fall aus den
Augen zu verlieren. Außerdem lässt sich anhand eines Counters verfolgen, welche Sneaker
in der Community aktuell besonders beliebt sind. Natürlich habt ihr dabei auch selbst die
Möglichkeit, sämtlichen Schuhen einen Up- oder Downvote zu geben.
An dieser Stelle hört es mit den Features natürlich noch nicht auf. Der integrierte Grailarm
informiert euch so nämlich rechtzeitig über alle unerwarteten Geschehnisse der Sneaker
Welt. Dazu gehören plötzliche Restocks, zu frühe Schuh Veröffentlichungen und vieles mehr.
Der Grailarm ist übrigens auch die beste Anlaufstelle für unsere Gewinnspiele und setzt euch auch über sie unmittelbar in Kenntnis.
Nicht zu vergessen ist auch die News Sektion innerhalb der Grailify App. Dort erhaltet ihr
nämlich sämtliche Neuigkeiten der Sneaker Szene und wisst dementsprechend immer, was
aktuell ist. So könnt ihr euch ganz leicht über derzeitige Gerüchte, Leaks, unsere neuesten
Pickups sowie First Looks und diverse andere Sneaker betreffende Themen informieren.
Wie ihr vielleicht inzwischen mitbekommen haben solltet, sorgen gerade die
unterschiedlichen Erinnerungen und Push-Benachrichtigungen dafür, dass ihr rechtzeitig
über die wichtigsten Vorkommnisse in Kenntnis gesetzt werdet. Wir sorgen natürlich dafür,
dass ihr wirklich nur die relevantesten Nachrichten erhaltet und man euch nicht mit
ständigen Pop-Ups überflutet.
Es gibt nämlich nichts Nervigeres auf dem Smartphone als eine installierte App, die
ununterbrochen nervige Töne und Benachrichtigungen von sich gibt. Alternativ könnt ihr
natürlich sämtliche Erinnerungen ausschalten. Wenn ihr dann allerdings mal einen wichtigen
Sneaker Release verpasst, haben wir euch zumindest gewarnt. 😉
Social-Media-Kanäle von Grailify
Unsere Social-Media-Kanäle gehören ebenfalls zu den populärsten Wegen, um sich täglich
mit den relevantesten News zu Sneaker Releases, Restocks und Gerüchten versorgen zu
lassen.
Dementsprechend stehen wir euch auf den gängigsten Plattformen wie Facebook,
Instagram, Twitter und TikTok zur Verfügung. So könnt ihr frei entscheiden, welche Art der
Infobeschaffung euch am besten zusagt.
Unabhängig von eurer Entscheidung könnt ihr uns dort natürlich völlig bequem mit nur
wenigen Klicks folgen und integriert unsere Sneaker News ganz unkompliziert in euren
persönlichen Feed. Da man sowieso schon jeden Tag viel Zeit auf den
Social-Media-Plattformen verbringt, ist es nämlich ziemlich nützlich, dort dann auch direkt
die neuesten Infos zu den gehyptesten Schuhen angezeigt zu bekommen.
Der Grailify YouTube Channel
Aufmerksamen Lesern dürfte jetzt wohl aufgefallen sein, dass YouTube eigentlich auch zu
den gängigen Social-Media-Plattformen gehört.
Wir nutzen unseren Channel allerdings eher weniger als Anlaufstelle für News, sondern eher
für On-Feet Videos und Unboxings. Häufig sehen die Sneaker auf den Produktbildern der
Hersteller nämlich gerne mal etwas anders aus und die Farben kommen meistens auch
völlig anders zum Vorschein als in der Realität.
Deshalb zeigen wir euch in unseren Videos, wie die gehyptesten Kicks getragen und vor
allem in natürlichem Licht ausschauen. Die realistische Inszenierung hat nämlich schon den
ein oder anderen Schuh ganz anders wirken lassen.
Nicht zu vergessen sind natürlich auch die erwähnten Unboxings auf unserem Kanal, bei
welchen wir sehr beliebte Sneaker auspacken und sie euch sehr detailliert präsentieren.
So könnt ihr vor eurem nächsten Cop nochmal ganz sichergehen, dass der jeweilige Schuh
weiterhin etwas für euch ist.

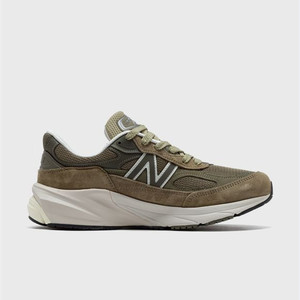






















.jpg)















.jpg)
.jpg)


